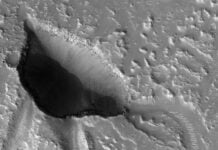Eine jahrhundertealte Technik des Gartenbaus – das Pfropfen – erlangt erneut Aufmerksamkeit als potenziell revolutionäre Methode zur Genbearbeitung einer Vielzahl von Pflanzen, insbesondere von solchen, die sich mit herkömmlichen Ansätzen als schwierig oder gar nicht zu modifizieren erwiesen haben. Diese innovative Strategie könnte die landwirtschaftliche Produktivität und den Nährwert erheblich steigern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft verringern und steigenden Lebensmittelpreisen entgegenwirken.
Die Herausforderung geneditierender Pflanzen
Die Fähigkeit, die Pflanzengenetik durch Genbearbeitungstechnologien wie CRISPR präzise zu verändern, bietet ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verbesserung der Ernteerträge und der Widerstandsfähigkeit. Allerdings kann die Modifizierung von Anlagen technisch anspruchsvoll sein. Im Gegensatz zu tierischen Zellen besitzen Pflanzenzellen starre Zellwände, was die Einführung von genetischem Material erschwert. Aktuelle gentechnische Techniken, wie das Brennen von DNA-beschichteten Pellets (Biolistik) oder der Einsatz des Bakteriums Agrobacterium, erfordern oft die Regeneration ganzer Pflanzen aus veränderten Zellen. Dieses Verfahren ist für viele wichtige Arten, darunter Kakao, Kaffee, Sonnenblumen, Maniok und Avocados, wirkungslos.
Regulatorische Hürden und alternative Ansätze
Selbst wenn die Genbearbeitung funktioniert, gibt es noch ein anderes Problem: die Regulierung. In einigen Ländern werden winzige, natürlich vorkommende Mutationen, die durch Gen-Editierung hervorgerufen werden, wie normale Pflanzenzüchtung behandelt und langwierige und kostspielige behördliche Versuche umgangen. Allerdings führen Methoden wie Biolistik und Agrobacterium oft zusätzliche DNA in das Genom der Pflanze ein, was einen umfassenden und strengeren regulatorischen Überprüfungsprozess auslöst. Wissenschaftler suchen aktiv nach alternativen Strategien, um dieses Problem zu umgehen und Genbearbeitungen ohne die Einführung fremder DNA zu ermöglichen.
Eine Möglichkeit besteht darin, Viren einzusetzen, um RNA-Kodierung für CRISPR-Komponenten bereitzustellen. Allerdings ist das Cas9-Protein, ein Schlüsselelement im CRISPR-Toolkit, relativ groß, was die RNA-Sequenzen begrenzt, die von den meisten Viren effektiv transportiert werden können.
Transplantation und RNA: Eine neue Kombination
Im Jahr 2023 stellten Forscher des Max-Planck-Instituts für molekulare Pflanzenphysiologie einen vielversprechenden neuen Ansatz vor. Sie erkannten, dass Pflanzen in ihren Wurzeln eine spezielle Art von RNA produzieren, die sich durch die Pflanze bewegen und in die Zellen in den Trieben und Blättern eindringen kann, und haben Pflanzen gentechnisch verändert, um solche RNAs zu produzieren. Diese RNAs kodierten für zwei wichtige CRISPR-Komponenten: das Cas-Protein, das die Bearbeitung durchführt, und die Leit-RNA, die es zum Zielort leitet. Anschließend pfropften sie Triebe unveränderter Pflanzen auf die Wurzeln dieser veränderten Pflanzen und erreichten so bei einigen Trieben und Samen erfolgreich eine Genbearbeitung.
Erweiterung der Möglichkeiten durch Pfropfen
Ugo Rogo von der Universität Pisa, Italien, und seine Kollegen glauben, dass diese Technik ein enormes Potenzial birgt und haben einen Artikel veröffentlicht, der zu einer weiteren Entwicklung anregt. „Die Veredelung gibt uns die Möglichkeit, das CRISPR-System in Bäumen oder Pflanzen wie Sonnenblumen einzusetzen“, erklärt Rogo.
Der Vorteil der Veredelung liegt in der Möglichkeit, relativ weit voneinander entfernt verwandte Pflanzen miteinander zu verbinden. Beispielsweise können Tomatensprossen erfolgreich auf Kartoffelunterlagen aufgepfropft werden. Das heißt, selbst wenn es unmöglich ist, einen Sonnenblumen-Wurzelstock direkt für die Genbearbeitung gentechnisch zu verändern, könnten Wissenschaftler möglicherweise eine verwandte Art so manipulieren, dass ein kompatibler Wurzelstock entsteht.
Ein universeller Wurzelstock für die Genbearbeitung
Sobald ein geeigneter Wurzelstock etabliert ist, der in der Lage ist, die notwendigen CRISPR-RNAs zu produzieren, kann er zur Genbearbeitung eines breiten Spektrums von Pflanzen verwendet werden. „Sie können die Wurzeln verwenden, um Cas9 und Bearbeitungsanleitungen für alle Arten von Elite-Sorten bereitzustellen“, bemerkt Julian Hibberd von der University of Cambridge.
Ralph Bock, ebenfalls am Max-Planck-Institut, hebt die Effizienz dieser Methode hervor: „Die Herstellung des transgenen Wurzelstocks ist kein großer Aufwand, da er nur einmal hergestellt werden muss und dann für immer und für mehrere Arten verwendet werden kann.“
Als konkretes Beispiel: Nur wenige Rebsorten wie Chardonnay können sich aus einzelnen Zellen regenerieren und sind für genetische Veränderungen zugänglich. Sobald jedoch durch Genbearbeitung ein krankheitsresistenter Chardonnay-Wurzelstock geschaffen wurde, könnte dieser für alle Rebsorten verwendet werden.
Kombination von Ansätzen für mehr Flexibilität
Rogo stellt sich eine Zukunft vor, in der Transplantation mit viraler Verabreichung kombiniert wird und so die Flexibilität maximiert wird. Wurzelstöcke könnten die für Cas9 erforderlichen großen mRNA-Sequenzen liefern, während Viren die kleineren Leit-RNAs liefern könnten. Diese integrierte Strategie würde es ermöglichen, denselben Wurzelstock für eine Vielzahl von Genbearbeitungen zu verwenden und so ein unglaublich vielseitiges Werkzeug zur Pflanzenverbesserung bereitzustellen.
Die innovative Transplantationstechnik bietet eine praktische und skalierbare Lösung zur Erweiterung der Möglichkeiten der Genbearbeitung und verspricht eine neue Ära des landwirtschaftlichen Fortschritts und eine größere Ernährungssicherheit für eine wachsende Welt.